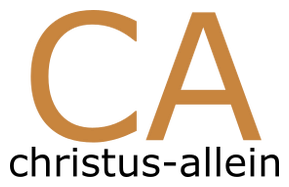Inhalt des Artikels
Vorbemerkung
Was ist geschehen? Was ist der Hintergrund dieser notvollen Entwicklung?
Der erste große Einbruch der Charismatischen Bewegung in die Gemeinschaftsbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Der tragische Niedergang des Pietismus, einer einst geschichtsmächtigen Erweckungsbewegung, wurde eingeleitet und nahm seinen Fortgang.
Der „Verlust“ des „Wortes Gottes“ hat schwerwiegende Folgen in Kirche und Pietismus.
Was geschieht in unserer christlichen Verkündigung?
Schlußwort: Ein erschütterndes Zeugnis, das für den Niedergang des Pietismus in unseren Tagen …
Vorbemerkung
Auch ich bin ein Kind des Pietismus. Außer meinen landeskirchlichen Wurzeln, verdanke ich viel und Entscheidendes den Begegnungen und Prägungen durch herausragende Persönlichkeiten des Pietismus.
Die Wikipedia-Datenbank enthält einen hervorragenden, umfassenden Artikel über „Pietismus“. Dort hören wir: „Der Pietismus (von lateinisch pietas; „Gottesfurcht“, „Frömmigkeit“) ist nach der Reformation die wichtigste Reformbewegung im kontinentaleuropäischen Protestantismus“.
Auch nicht annähernd kann in diesem Artikel die Komplexheit und Vielgestaltigkeit des Pietismus dargestellt werden. Aber auf eines, was zentral dieser geschichtsmächtigen Bewegung eigen war, soll hier in die Mitte gestellt und zugleich hinterfragt werden.
Ich zitiere weiter aus dem Artikel über Pietismus in der Wikipedia-Datenbank:
„Als positive Selbstbezeichnung hat erstmals der pietistische Leipziger Poesie- Professor Joachim Feller (1638-1691) das Wort „Pietist“ verwendet, beispielsweise im August des Jahres 1689 in dem Sonett auf den verstorbenen Leipziger Theologiestudenten Martin Born (1666-1689):
Es ist jetzt Stadt-bekannt der Nahm der Pietisten;
Was ist ein Pietist? Der Gottes Wort studiert
Und nach demselben auch ein heilges Leben führt.“
Das war das Kennzeichen des Pietismus durch die Jahrhunderte hindurch, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, und in Teilen des Pietismus darüber hinaus:
Die Liebe zur Heiligen Schrift, zu „Gottes Wort“, und zugleich die Sorge, dass dieses „Wort“ im Leben auch Gestalt gewinnt.
Wir wollen nachfragen: Ist das heute noch das Erkennungszeichen des Pietismus? Oder hat der moderne Pietismus dieses Kennzeichen verloren? Ist gar der Niedergang des Pietismus eingeleitet?
Die Ausführungen werden zeigen, dass Letzteres leider zu bejahen ist.
Umso mehr wollen wir das kostbare Erbe des Pietismus bewahren und weitertragen. Kirche und Pietismus brauchen das „Kirchlein in der Kirche“ (ecclesiola in ecclesia), nötiger denn je. Es ist ein Ausdruck, den der lutherische Theologe Philipp Jakob Spener im 17. Jahrhundert formuliert hat. Er gehörte zu den Gründerpersönlichkeiten des lutherisch geprägten Pietismus.
Die Evangelische Kirche und der gegenwärtige Pietismus brauchen Kraftzellen, die dem Zerfall entgegenwirken, nicht Kraftzellen, die ein Insel-Dasein führen und sich abspalten.
Es bedarf der Menschen, die dem „Wort Gottes“ seine weltumwandelnde Kraft glauben, die vertrauen, dass „Gottes Wort“ aus Nichts etwas schaffen kann, die selbst aus den Kraftquellen leben, die Gott seiner Gemeinde geschenkt hat, in den „Gnadenmitteln“ „Wort“ und „Sakrament“. Wir brauchen Menschen, die glauben, „was geschrieben steht“, und die überzeugt sind:
Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir;
denn ich zieh es aller Habe
und dem größten Reichtum für.
Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten,
worauf soll der Glaube ruhn?
Mir ist‘s nicht um tausend Welten,
aber um dein Wort zu tun“.
(Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760(
Diesen Weg können wir nur gemeinsam in brüderlicher Verbundenheit gehen. Das ist auch das Erbe des Pietismus, das wir bewahren wollen, „alle, die mit Ernst Christ sein wollen“.
Ein wichtiges Datum in der Geschichte des Pietismus war in den 1960-iger der „Gemeindetag unter dem Wort“ in Dortmund. Dort geschah eine deutliche Absage der Bibeltreuen Gemeinde an die Bibel-zersetzende Theologie, die führende Universitäts- Theologen vertraten.
Ganz im Geiste der Aufklärung, ließen die Kirchenleitungen der Evangelischen Kirchen, um der „freien“ Forschung willen, diese Irrlehren gewähren, die dann bald Eingang in die Gemeinden fanden, und dort ihr Zerstörungswerk anrichteten. Es waren Irrlehren, die seit der „Aufklärung“ im Kern schon vorhanden waren, jetzt aber offen und ungeniert zu Tage traten, und zuletzt die Auflösung der Autorität des Wortes Gottes betrieben.
Der Widerstand formierte sich aus den Kreisen des Pietismus, einer Erweckungsbewegung in und außerhalb der Evangelischen Kirchen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann und bis in unsere Tage von Bedeutung ist. Dort wo der Aufbruch des Pietismus in den Kirchen geschah, war diese Bewegung eine korrigierende und stärkende Kraft inmitten der Kirche, besonders in der Württembergischen Evangelischen Landeskirche.
Die Heilige Schrift und die Bekenntnisse der Reformation, und damit das Grundverfassung der Evangelischen Kirchen, waren dem Pietismus zentrales Anliegen. „Die mit Ernst Christen sein wollten“, trafen sich zusätzlich zum Gottesdienst in privaten Versammlungen, um Gottes Wort zu betrachten und christliche Gemeinschaft zu pflegen. So hatte es schon Martin Luther in den Anfängen der Evangelischen Kirche empfohlen. Die „Pietisten“ wollten „Kirchlein in der Kirche“ sein (ecclesiola in ecclesia).
Im Pietismus war man sich damals mit vielen in der Evangelischen Kirche einig, dass für das überlieferte „Wort Gottes“ zu streiten notwendig sei, wenn sein Geltungsanspruch in Frage gestellt wird. Die Aufgabe der Begründung und Verteidigung des Evangelischen Glaubens gehörte jahrhundertelang zum selbstverständlichen Rüstzeug der Evangelischen Kirche, und war Anliegen und ein gutes Erbe auch im Pietismus. Die Wahrheit muss gegen die Unwahrheit immer neu bezeugt werden.
An der Seite weniger theologischer Lehrer hatte der Pietismus diese Aufgabe übernommen, dem verheerenden Ausmaß zersetzender Bibel-Kritik entgegenzutreten.
In der „Frankfurter Erklärung zur Grundlagenkrise der Mission“ im Jahre 1970, hat der Pietismus noch einmal Stellung genommen, was Auftrag der Kirche in der „Mission“, nach biblischem Zeugnis, nach wie vor ist. Die Evangelische Kirche hatte mit dem Verlust der Autorität des Wortes Gottes auch ihre Mitte verloren. Sie suchte nun die Leere mit einem entleerten Missionsbegriff zu füllen. Im „Dialog“ wurde nun die gegenseitige Anerkennung der verschiedenen Kirchen beabsichtigt und gesucht, in einem fragwürdigen Ökumenismus den Utopien des Weltkirchenrats in Genf geglaubt, und dabei die Wahrheit des Evangeliums geopfert. Noch einmal erhob hier der Pietismus in erstaunlicher Geschlossenheit seine Stimme.
Inzwischen hat der Pietismus in unseren Tagen aber seine Kraft und Klarheit zur notwendigen theologischen Auseinandersetzung verloren. Er vermag nicht mehr mit Vollmacht die Stimme zu erheben gegen die Irrwege der Kirche, und wohl noch tragischer, er hat seinen Wachsamkeit nach innen verloren, in Kampf und Anfechtung das Wort Gottes in den eigenen Reihen zu bewahren.
Was ist geschehen? Was ist der Hintergrund dieser notvollen Entwicklung?
Eine wesentliche Ursache für den Abbruch und Verlust dieses Auftrags, in Vollmacht der Evangelischen Kirche auch zu widersprechen, und Kirche und Welt den biblischen Weg zu weisen, ja, auch darauf zu achten, selbst auf dem biblischen Weg zu bleiben, war der leise, aber unaufhaltsame erneute Einbruch der Charismatischen Bewegung in die Gemeinschaftsbewegung in den 1960-iger Jahren, nachdem sie 1909 schon einmal einen ersten Einbruch nur mit Mühe überstanden hatte. Eben in den Jahres des mutigen Bekennens des Pietismus in den 1960-iger Jahren, erstand erneut eine mächtige Bewegung, die die Autorität des Wortes Gottes verwarf.
Der erste große Einbruch der Charismatischen Bewegung in die Gemeinschaftsbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts.
1907 drang die Charismatische Bewegung von Los Angeles in Amerika kommend nach Europa und fand auch in Deutschland die ersten Anhänger. Mit dieser neuen Bewegung drang aber ein „anderer“ Geist in die geistlich gesunde Gemeinschaftsbewegung in unserem Land ein, und drohte die Gemeinschaftsbewegung zu zerstören.
Es begann ein zweijähriges Ringen der Gemeinschaftsbewegung mit dieser neuen, fragwürdigen Bewegung. Die führenden Vertreter der Gemeinschaftsbewegung, darunter Johannes Seitz, Otto Stockmayer, Ernst Modersohn und viele andere, kamen schließlich zu einem schmerzhaft errungenen, aber unerbittlichen Urteil in der Berliner Erklärung im Jahre 1909. Das Urteil lautete: Dieser „neue“ Geist sei ein Geist „von unten“ und nicht „von oben“. Mit anderen Worten: Er entspringe somit aus widergöttlicher, „satanischer“ Quelle.
Die Berliner Erklärung von 1909 war seitdem für den Pietismus und die Gemeinschaftsbewegung ein Bollwerk gegen den neuen Schwarmgeist, für ungefähr 50 Jahre. Die unterzeichneten Brüder empfahlen, mit den Geschwistern der Pfingstbewegung (ihr Christsein wurde ihnen aber nicht abgesprochen) keine gemeinsame Sache zu machen. Ein langes geistliches Ringen führte zu dem harten, aber notwendigen Urteil. Zuletzt war dieses Urteil nur möglich durch die (heute weithin vergessene) Gnadengabe der „Unterscheidung der Geister“. (1 Kor.12,10)
Der „neue Geist“ propagierte ein „Mehr“ für Leben und Glauben, aber ein „Mehr“ über die allein genügende, vor Gott rechtfertigende Gnade hinaus, und führte damit suchende Christen in die Irre. So entpuppte sich der neue Geist nicht als der Heilige Geist, weil er Gottes Wort verachtete.
Mit der Berliner Erklärung im Jahre 1909 trennte sich der Pietismus damals radikal von der Charismatischen Bewegung.
Aber dann, wie erwähnt, 50 Jahre danach, in den 1960-iger Jahren, als die Gemeinschaftsbewegung sich als bekennende Gemeinde formierte und öffentlich Widerspruch erhob, erfolgte ein erneutes Aufwachen der Charismatischen Bewegung. Jetzt aber, nicht nur im Rahmen der Gemeinschaftsbewegung, sondern auch inmitten der Evangelischen Kirchen und in der Katholischen Kirche.
Dieser erneute „Angriff“ sollte „erfolgreich“ werden. Die Gemeinschaftsbewegung öffnete sich nach und nach dem „neuen“ Geist in diesen Jahren.
Der Warnruf der Väter von 1905 wurde von vielen Verantwortlichen in den Wind geschlagen.
Der „Angriff“ der Charismatiker war ein altes Leiden der Kirche.
Die „Wiedertäufer“ der Reformationszeit, auch „Schwärmer“ genannt, gaben ihrem „Inneren Licht“, in Form von Offenbarungen, Gesichten, usw., den gleichen Rang wie dem „Wort Gottes“. Luther stellte diese Charismatiker in Frage, weil sie nicht bereit waren ihr „Inneres Licht“ unter das „Wort Gottes“, die Heilige Schrift, zu stellen, und damit offenbarten, „wes‘ Geistes Kind“ sie waren.
Dieses „charismatische“ Phänomen begleitete die Kirche Jesu Christi seit ihrer Frühzeit und ist in Form der „Charismatischen Bewegung“ nichts wirklich Neues, hat aber auch nichts von seiner Glauben-zerstörenden, weil vom Wort Gottes wegführenden Gefähr- lichkeit verloren.
In der Charismatische Bewegung wird das Wort Gottes an den Rand gedrängt, relativiert, damit aber verworfen.
Die praktizierten Geistesgaben kennzeichnet eine Eigendynamik. Aber gerade darin erweisen sie sich nicht als echte Geistesgaben, d.h. als Gaben des Heiligen Geistes. Sie behaupten sich auch hier neben dem Wort Gottes, gegen das Wort Gottes oder dem Wort Gottes überlegen. Sie stellen sich nicht unter das Wort. Sie werden gewöhnlich auch nicht durch Wort Gottes geprüft, und damit von ihm nicht regiert.
Der Preis für diese neue Öffnung zu einer neuen fragwürdigen Einheit, war groß. Wo die Gemeinschaftsbewegung sich vereinnahmen ließ, verlor sie in der Folge alle Unterscheidungsfähigkeit und konnte den Kampf mit den verschiedenen Geistern nicht mehr aufnehmen. Man erhoffte eine Verstärkung der Gemeinschaftsbewegung durch den neuen Schulterschluss, erreichte aber das Gegenteil. Man wurde nur ein Zerrbild dessen, was in den Kirchen schon geschah. Man passte sich den Evangelischen Kirchen an, die in der weltweiten Ökumene, im Weltrat der Kirchen, längst die charismatischen Kirchen vereinnahmt hatten, die sich als Fluidum „bewährten“, Lehrfragen als belanglos anzusehen. Man genoss damit auch bald größeres kirchliches Ansehen. Aber man verschleuderte sein Erstgeburtsrecht um ein „Linsengericht“.
Der tragische Niedergang des Pietismus, einer einst geschichtsmächtigen Erweckungsbewegung, wurde eingeleitet und nahm seinen Fortgang.
Was geschah weiter nach dem erneuten Aufbruch der Charismatischen Bewegung und ihrem Eindringen in die Gemeinschaftsbewegung seit den 1960-iger Jahren?
Ungefähr 30 Jahre später, am 1. Juli 1996, vollendete die Charismatische Bewegung ihren Siegeszug gegen die Gemeinschaftsbewegung. Der Hauptvorstand der Evangelischen Allianz und das Präsidium des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP), verabschiedeten die Kasseler Erklärung, die die Berliner Erklärung von 1909 relativieren und überwinden sollte, im Grunde aber die Berliner Erklärung aufhob.
(Genauere Informationen und in die Geschehnisse tiefer einführend bietet die Ausführung von Wolfgang Nestvogel: „Die doppelte Aktualität der Berliner Erklärung im Jahr 1999“, in: 90 Jahre Berliner Erklärung, idea Dokumentation 14/1999, S.20-26.)
Die Charismatischen Gemeinden wurden damit offiziell und endgültig in das Boot der Gemeinschaftsbewegung und der Evangelischen Allianz gehoben. Damit hatte aber der Pietismus den „Absolutheitsanspruch“ des „Wortes Gottes“ offiziell aufgegeben. Eine Auseinandersetzung mit dem Schwarmgeist war deshalb nun nicht mehr möglich, weil sie nur in der Vollmacht des „Wortes Gottes“ geführt werden kann.
Nun war man Im Schlepptau der tragischen Entwicklung der Evangelischen Kirche. Ein ähnlicher Prozess fand nun im Pietismus statt. Der Verlust des Wortes Gottes und einer bisher geschenkten Vollmacht, führte die evangelikalen Gemeinden in die gleiche Richtung wie die Evangelischen Kirchen: Das „Wort Gottes“ wurde relativiert. Aus dem „Wort“ wurden die vielen „Wörter“. Man machte sich auf die Suche nach immer aufregenderen Gottesdienstformen und lief ständig den Ansprüchen der Moderne nach. Ein vermeintlich moderneres pietistisches Selbstbewusstsein stellte sich ein: Man fühlte sich nun up-to-date, und nicht mehr so sehr der Nichtbeachtung und dem Spott der Gesellschaft ausgeliefert. Aber nun fehlte eine klare Identität, die dem Pietismus früher eigen war: Nämlich der Gehorsam Gottes Wort gegenüber in Lehre und Leben, und die Achtung gegenüber den Bekenntnissen der Reformation. Es fehlte nun dieser geltende und schützende Rahmen, der ein gesundes, geistliches Leben in der Gemeinschaftsbewegung bisher ermöglichte. Derselbe Schaden war eingekehrt, der schon die Evangelischen Kirchen lähmte.
Aus der Einfalt der Liebe zum Wort Gottes, wurde auch hier die fragwürdige Vielfalt, der Einbruch der Säkularisierung in die pietistischen Gemeinden.
Das Wort der Heiligen Schrift verträgt aber nichts neben sich. Gott redet hier. Nichts kann und darf bestehen neben der Majestät des Wortes Gottes. Was sich daneben erhebt wäre anmaßende Gotteslästerung, die Verwerfung des Wortes Gottes.
Der „Verlust“ des „Wortes Gottes“ hat schwerwiegende Folgen in Kirche und Pietismus:
Die unheimlichste Folge: Das „Wort“, das vom Tode zum Leben führt, ist nicht mehr da. Wie soll nun Leben entstehen, das Hoffnung hat über den Tod hinaus? Wie können wir nun „Licht der Welt“ sein? „Salz der Erde“? Wie können wir nun den Menschen das sagen, was sie sich nicht selbst sagen können?
Wenn kein „Botschafter an Christi Statt“ (2 Kor 5, 20ff) mehr da ist? Wenn keiner mehr „Sünder“ unter das „Kreuz Christi“ führen und den Weg vom „Tode“ zum „Leben“ zeigen kann? Wenn keiner mehr helfen kann, dass ein Mensch die ganze Herrlichkeit der Fülle der Gnade in Buße und Vergebung erfahren darf?
Diesen Auftrag können wir nur erfüllen, wenn Gottes kostbares Wort uns heilig ist, wenn Gott dieses Wort in unseren Mund legen kann.
Ohne die Vollmacht des „Wortes Gottes“ eine „Evangelisation“ durchführen zu wollen, muss scheitern und verdient diesen Namen nicht. Das Ergebnis wäre nur „religiöse Animation“, Unterhaltung mit christlichem Vorzeichen.
Das ist gegen Pro Christ einzuwenden.
Die Verantwortlichen begannen mit einem ungeklärten Verhältnis zur Katholischen Kirche und unter Einbeziehung der Charismatischen Gemeinden. Wie kann hier das Wort Gottes in Vollmacht verkündigt werden? Das Ergebnis kann nur religiöse Unterhaltung sein, die den Zuhörer in seinem mitgebrachten Elend belässt, ihn aber nicht aus dem „Sündenschlaf“ erweckt, sondern ihn zuletzt in sein altes Dasein zurückstößt. Mit seinen guten Vorsätzen entlässt man ihn z.B. in die Katholische Kirche, wo er sein „Heil“ mühsam und unter großen Opfern verdienen muss, oder man zeigt ihm den Weg in eine charismatische Gemeinde, wo er die geistliche „Aufladung“ an den charismatischen Kontaktstellen lernen soll, um schließlich unerlöst und getäuscht zurück zu bleiben. Viele Menschen werden immun gegen den christlichen Glauben nach solchen „christlichen“ Erfahrungen.
Was geschieht in unserer christlichen Verkündigung? Ein „Geruch vom Tode zum Tode“ oder ein „Geruch vom Leben zum Leben“ (2.Kor.2,16) ?
Eine weitere Folge ist eine theologische Indifferenz, die zum Kennzeichen des Einzelnen und der Gemeinde wird.
Die Wahrheit des Wortes Gottes und andere Wahrheiten werden dann gleich-gültig. Der Kampf um die Wahrheit und den rechten Glauben findet nicht mehr statt. Er ist der Gleich-Gültigkeit gewichen. Nun ist die Gemeinde aber schutzlos der falschen Lehre ausgeliefert.
Eine weitere Folge ist die Unfähigkeit, die Evangelische Kirche von der Katholischen Kirche zu unterscheiden.
Deutlich ist eine Re-Katholisierung der Frömmigkeitspraxis zu beobachten, sowohl in der Evangelischen Kirche als auch in der Evangelikalen Bewegung, wenn Stille- Übungen, Exerzitien, Meditationstechniken, u.ä. in den Mittelpunkt rücken.
Eine weitere Folge ist, dass „Gemeinsame Aktionen“ Priorität haben, gegenüber der (regelmäßig ausbleibenden) Lehrauseinandersetzung, dem Ringen um die Wahrheit und den rechten Weg, das einer gemeinsamen „Aktion“ eigentlich vorausgehen müsste.
Die meisten kirchlichen Aktivitäten tragen längst dieses Siegel, und inzwischen hat diese Praxis auch beim „Einheits-Rausch“ in der gegenwärtigen Evangelischen Allianz Einzug gehalten. Wenn nur der Name „Jesus“ vorkommt, erhält eine christliche Gemeinschaft den Ritterschlag, um Mitglied im großen „Eins-Verein“ zu werden. Was ist das für eine Theologie- und Bibel-vergessene „Einheits-Sucht“, die nicht mehr das warnende Wort Jesu kennt: „Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel“ Mt. 7,21). Jesus sagt dort in Mt 7, die „Herr, Herr!“-Sager hätten in seinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben und viele Machttaten getan (..das ist der Anspruch vieler Charismatiker). Aber Jesus urteilte: „Ich habe euch nie gekannt“ (Mt.7,23).
Eine weitere Folge wird offenbar in der Glaubens- und Kraftlosigkeit der Diakonie.
Der Anspruch, christliche Diakonie zu sein, wurde in der kirchlich getragenen und verantworteten Diakonie weithin aufgegeben, in emsig verfassten „Leitbildern“ zwar noch formuliert, aber de facto aufgegeben. Wo pietistische Einrichtungen sich der Diakonie annehmen, ist noch am ehesten das „Dienen um Christi willen“ gegeben. Aber wo ist auch hier der Aufbruch zu Einrichtungen der Barmherzigkeit, die genauso wie vor 150 Jahren nötig wären? Wie anders war der Aufbruch der Diakonie und ihrer Werke im 19. und 20. Jahrhundert. Sie wurden nicht durch Subventionen ins Leben gerufen, sie waren aber Werke des Glaubens, Früchte des Glaubens, die zu Tage traten. Der Leitspruch, den Friedrich von Bodelschwingh in Bethel sich wählte, macht das deutlich: „Weil uns Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde“ (2 Kor 4,1). Man findet nicht mehr den Weg zur „Inneren Mission“. Man gründet keine
Rettungshäuser für die Elenden und Suchenden der Gesellschaft mehr. Man lebt nicht mehr zuallererst vom Wort Gottes, das uns Gottes Erbarmen zuspricht, und uns dann zum Erbarmen für den Nächsten fähig macht. Man herrscht lieber, als dass man dient. Heute ist uns etwa das Gelübde der früheren Diakonissen gänzlich fremd geworden, die ihren Dienst so begannen: „Was will ich? Dienen will ich! Was ist mein Lohn? Mein Lohn ist, dass ich darf!“ Wir feiern lieber uns selbst, als mit den Sündern zu feiern, „die Buße tun“.
Nicht mehr die „Nachfolge Jesu“ und „Sein Kreuz auf sich zu nehmen“, stehen im alles bestimmenden Mittelpunkt des Glaubens und Lebens, sondern viel eher ein christlich- religiöses „Wohlfühl-Christentum“, das in oft lukrativen christlichen Einrichtungen angeboten wird.
So müssen wir, auch wenn es uns als strenges Urteil erscheint, vom Niedergang des Pietismus reden.
Ein erschütterndes Zeugnis, das für den Niedergang des Pietismus in unseren Tagen ein beredtes Zeugnis ablegt, soll hier an den Schluss gestellt werden.
Bei der Abstimmung über „Homo-Ehe – Ehe für alle“ – am Sa. 23.03.2019 in der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg in Stuttgart,
haben 90 von 98 Synodalen abgestimmt: (2 Enthaltungen, 23 Nein-Stimmen, 65 Ja- Stimmen). Mit den 65 Ja-Stimmen war eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht, und damit ein grundsätzliches „Ja“ zur Homo-Ehe gesprochen. Einschränkungen gab es nur noch formaler Art: Die Anzahl der Kirchengemeinden, denen die Praxis erlaubt wird und eine Regelung, wie Pfarrer und Kirchengemeinderäte ihr eigenes Ja oder Nein einbringen können.
Der Leiter des pietistischen Netzwerks Lebendige Gemeinde, Dekan Albrecht, sagte der Presse: (Schwarzwälder Bote 25.03.2019):
„Einige der Stimmen kamen auch aus den Reihen der Lebendigen Gemeinde – zum einen, um eine Ordnung herzustellen und dem Wildwuchs zu wehren, zum anderen, um die Einheit in der Kirche nicht zu gefährden“.
Haben wir richtig gehört? Damit wurde Gottes Wort verworfen. Nun steht auch der Pietismus unter dem Gericht Gottes, im Schlepptau der Evangelischen.Kirche.
Pfarrer.i.R. Friedemann Schwarz, Gartenstraße 21, 72227 Egenhausen